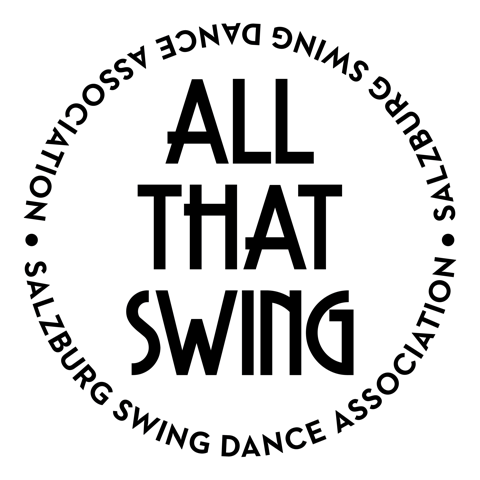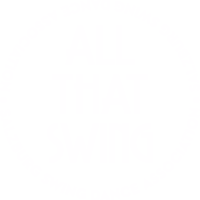Lindy Hop: einer der ersten Swingtänze aus Harlem, New York
„Lindy hops off to Paris“ oder was Charles Lindbergh mit dem Savoy Ballroom zu tun hat
Für viele ist er der Inbegriff aller Swingtänze: der Lindy Hop. Sein bekanntester Urvater? Zweifelsohne Frankie Manning. Denn er gilt als Erfinder der sogenannten Airsteps. Der Tanz entstand in den 1920er Jahren in den großen Ballsälen New Yorks zur Musik der Big Bands, die die Jazzmusik zur orchestralen Swingmusik weiterentwickelten. Woher aber kommt der Name Lindy Hop?
Hierzu gibt es mehrere Geschichten, hier ist eine davon: mehrere Zeitungen brachten 1927 klingende Schlagzeilen rund um Charles Lindberghs Versuch, zum ersten Mal per Flugzeug den Atlantik zu überqueren. Sie lauten “Lindy hops off for Paris”, oder “Lindbergh does it: flies across the Atlantik in 33 hours” als er nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen glücklich in Paris ankommt. Als ein Journalist eines Abends einen Tänzer in Harlems Savoy Ballroom befragte, was er da genau tanzte, entgegnetet dieser: “Den Lindbergh Hop“. Dieser Tänzer war anscheinend niemand geringer als “Shorty” George Snowden. Allerdings beansprucht auch Frankie Manning genau diese Episosode für sich – nachzulesen in seiner Biographie. Aus Lindbergh Hop wurde schließlich kurzerhand Lindy Hop. Egal, wer dem Inbegriff aller Swingtänze tatsächlich seinen klingenden Namen verliehen hat, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir auch heute noch “Lindy” tanzen.
Vielfältige Wurzeln, viel Raum für Kreativität
Lindy Hop, entstand mit Ende der 1920er Jahre und erlebte seine Blütezeit in den 1930er Jahren. Er gilt als einer der frühesten Swingtänze. Zu den Wurzeln des Lindy Hop zählen 1920s Charleston, Balboa, Collegiate Shag, aber auch der Blues. Die Energie des Tanzes, die jazztypische Improvisation und die Offenheit für andere musikalische und tänzerische Einflüsse hat zu einem weiten Spektrum an typischen Bewegungselementen geführt, das sich bis heute weiter entwickelt und erweitert. Charakteristisch für den Lindy Hop sind die schnellen und raumgreifenden Figuren wie etwa der Swingout, oder der Lindy Turn, bei dem sich die Tänzer in zwei Takten 360 Grad umeinander drehen. Der Tanz ist sehr stark improvisiert, was viel Raum für die Interpretation und Kreativität der Tanzpartner lässt.
It’s all about Style: Savoy Style versus Hollywood Style
Auch wenn der Lindy Hop in Harlem entstand – geblieben ist er dort nicht. Im Laufe der Zeit erfasste der Swing, und mit ihm der Lindy Hop, auch den Rest Amerikas und landete, last but not least, in Hollywood und auf der großen Leinwand.
Die Unterschiede zwischen dem, was auf Originalaufnahmen aus dem Savoy Ballroom sowie den Auftritten originaler Savoy-Tänzer in Hollywoodfilmen und den Swingszenen in Filmen, die Südkalifornische Tänzer zeigen, zu sehen ist, haben in jüngerer Vergangenheit zu einer Unterscheidung zwischen zwei Arten, den Lindy Hop zu tanzen, geführt.
Wer sich ein wenig eingehender mit der Geschichte des Lindy Hop beschäftigen will und auch vor einer längeren Lektüre nicht zurückschreckt, dem sei der umfassend recherchierte Artikel von Bobby White auf Swungover ans Herz gelegt. Dort kann man nicht nur nachlesen, worin die Unterschiede zwischen Savoy Style und Hollywood Style angeblich bestehen, sondern auch, warum eine solche Trennung nicht unbedingt sinnvoll ist.
Vor allem die Medien und die weiße Bevölkerung nannten den Lindy Hop auch „Jitterbug”. Die GIs brachten ihn während und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa. Hier entwickelte sich daraus unter dem Einfluss des etwas anderen Sounds der europäischen Tanzbands und der tänzerischen Fertigkeiten der europäischen Mädchen der Boogie-Woogie, für den der Hollywood Style wohl das wichtigere Vorbild war.
Das Ende der Swingära, was danach kam & das schwedische Revival
Mit Rock ’n’ Roll, der aufstrebenden Disko-Kultur und dem Niedergang der Big Bands verlor der Swing nach und nach an Beliebtheit. Reste hielten sich im East Caost und West Coast Swing in den USA, im Ceroc, LeRoc oder Roc in Frankreich und Großbritannien und im Bugg in Schweden. Der Rock’n Roll und auch der Jive, spiegeln einige der Grundelemente des Swing bis heute wieder.
Seit etwa 1985 gibt es (übrigens auch pararell mit dem argentinischen Tango und kubanischen Salsa) ein Lindy-Hop-Revival, das in Europa hauptsächlich von Schweden ausging. Dort findet auch einer der alljährlichen internationalen Swing-Höhepunkte, ein fünfwöchiges Swing-Camp im schwedischen Herräng, statt.
Alles andere als Standard
Lindy Hop ist, gerade weil es keinen „standardisierten“ Schritt, kein Tanzprogramm oder nach strengen Regeln festgelegte Figuren gibt, ein Tanz, der es möglich macht, dass Tänzer weltweit mit unterschiedlichsten Partnern ihrer Kreativität mittels Improvisiation freien Raum lassen. Im Tanzen selbst ensteht ein spannender Dialog. Es gibt auch keinen festgelegten Konsens der Trainer, wie die Technik am Besten funktioniert. Genausowenig ist festgehalten, was die beste Methode ist, Lindy Hop zu unterrichten. Der Urtanz des Swings ist genau darauf ausgelegt, mit beliebigen Partnern improvisieren zu können. Aus diesem Pluralismus, dem Zusammentreffen unterschiedlicher Technik und unterschiedlicher Stile, entsteht sehr viel Reiz. Denn durch den Austausch im Tanzen selbst entsteht viel Neues. Kein Wunder also, dass es für „Lindy Hopper“ kaum etwas Aufregenderes gibt, als ein internationalen Swing-Event zu besuchen, oder gar an einem „Lindy Exchange“ in einer anderen Stadt teilzunehmen.